
Das Herz-Jesu Krankenhaus Wien punktet im Kampf gegen postoperative Verwirrtheit mit einer hochspezialisierten Behandlung durch Advanced Practice Nurses.
Text: Karin Lehner
Verwirrtheit, Unruhe, Desorientierung und die Störung des Tag-Nacht-Rhythmus zählen zu den Symptomen des postoperativen Delirs. Es kann die Folge großer OPs mit längerer Narkose sein, langen Krankenhausaufenthalten, Medikamenten für Schlaf und Entwässerung, eines Ortswechsel und von Schmerzen oder Stress. Der Zustand kann ein paar Stunden, Tage, Wochen oder sogar Monate andauern.
Laut der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie entwickelt rund ein Drittel aller älteren stationären Patient*innen ein postoperatives Delir. Das höchste Risiko tragen Menschen über 70 mit körperlichen oder kognitiven Vorerkrankungen, zum Beispiel einer Demenz. Bei älteren multimorbiden Patient*innen erleidet zirka jede*r Fünfte*r ein Delir, weiß Mag.a Cornelia Kelterer. Als DGKP am Herz-Jesu Krankenhaus Wien hat sie ein Studium auf Masterniveau mit zusätzlicher Spezialisierung auf Demenz und Delir abgeschlossen. Nun widmet sie sich als Advanced Practice Nurse (APN) dem professionellen Delir-Management, als eine von wenigen in Österreich. Sie führt Schulungen für das Gesundheitspersonal durch, begleitet oder berät Patient*innen wie Angehörige, implementiert evidenzbasierte Leitlinien, fördert den fachlichen Wissenstransfer in die Praxis und koordiniert ein multiprofessionelles Team aus Medizin, Anästhesie sowie Pflege. „Durch frühzeitige Risikoerkennung, strukturierte Präventionsmaßnahmen und enge interprofessionelle Zusammenarbeit verbessert sich die Qualität in der Versorgung von Patient*innen. Rasch erkannt, ist ein Delir in den meisten Fällen reversibel,“ sagt Cornelia Kelterer.

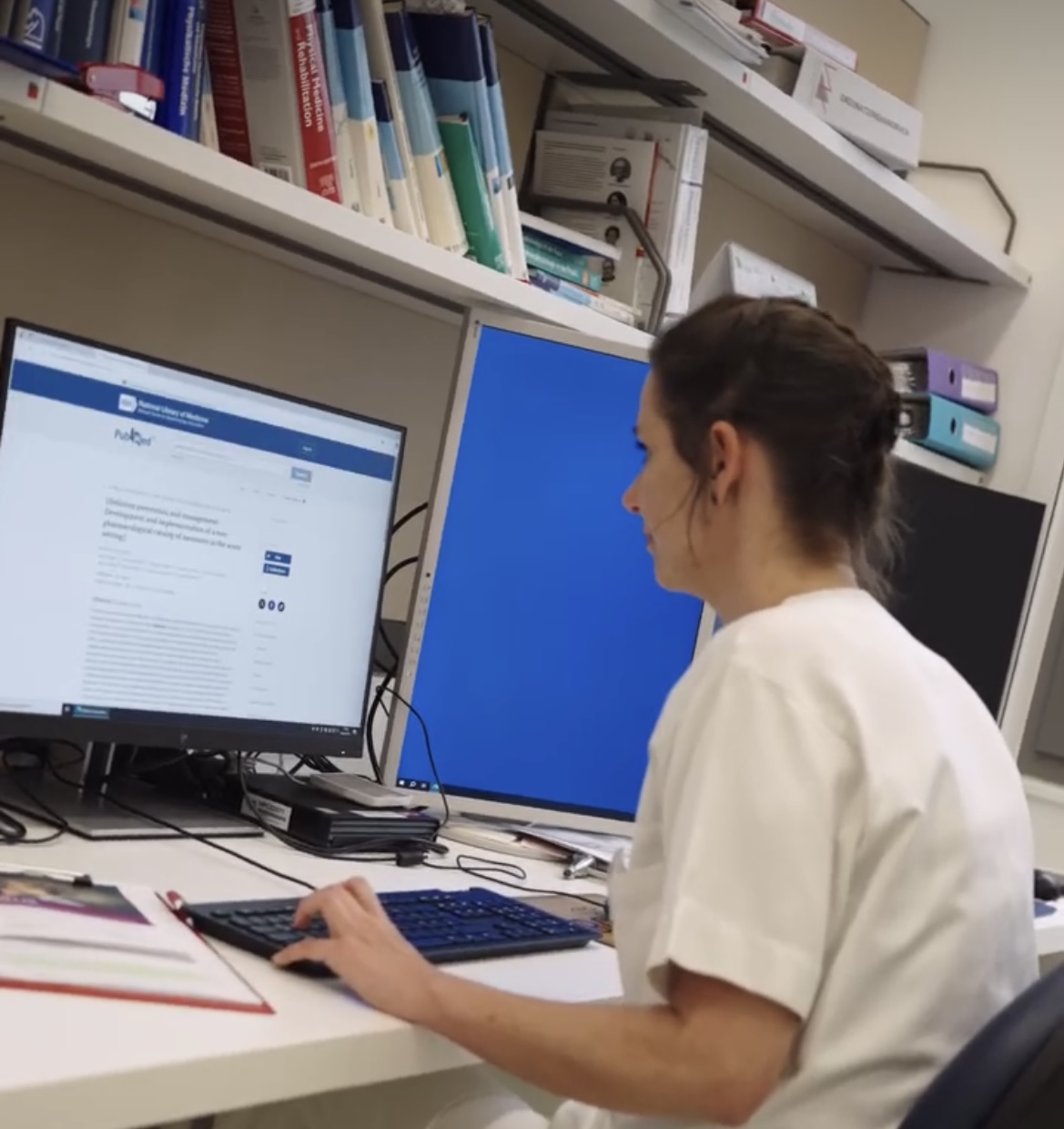

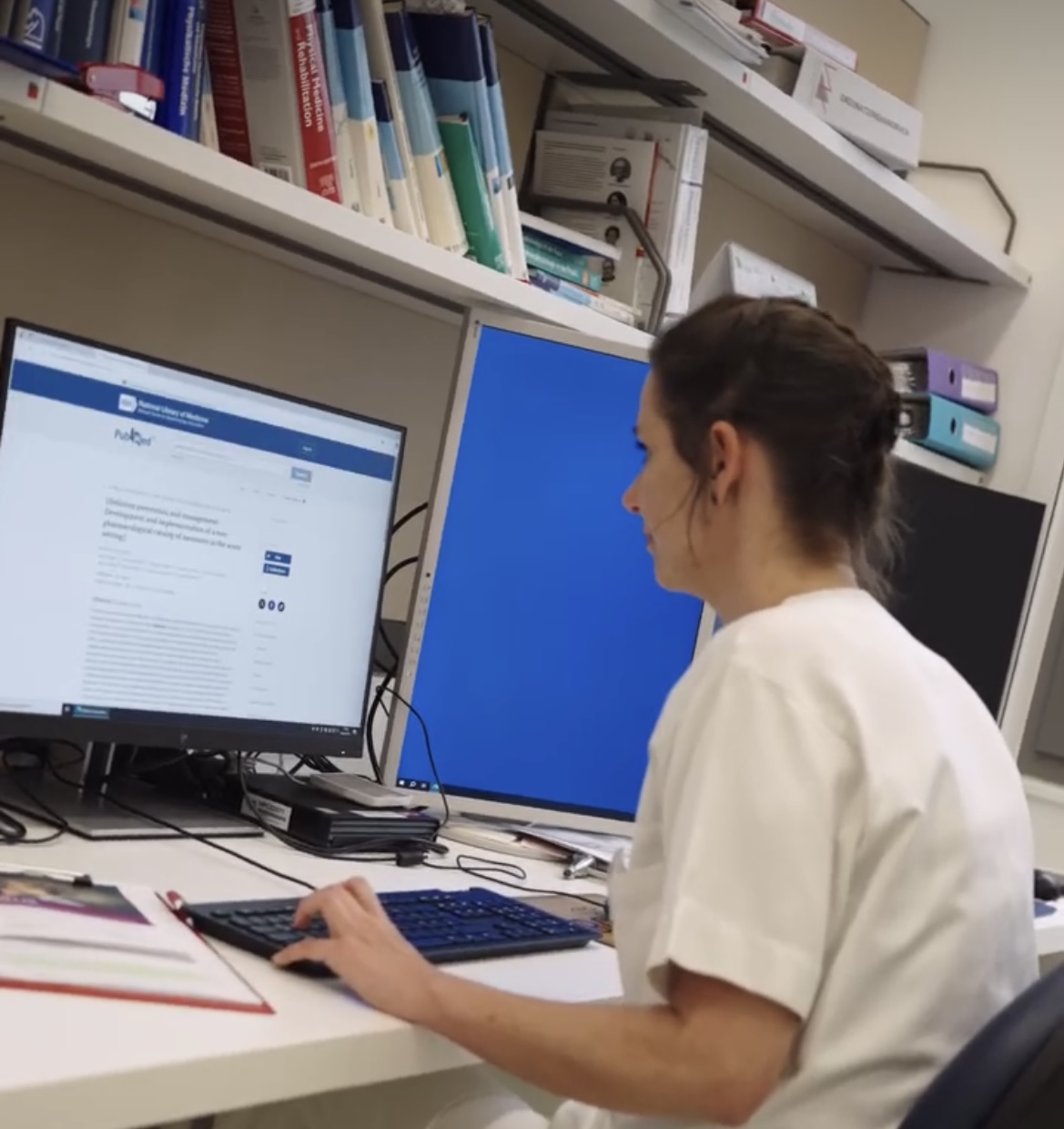


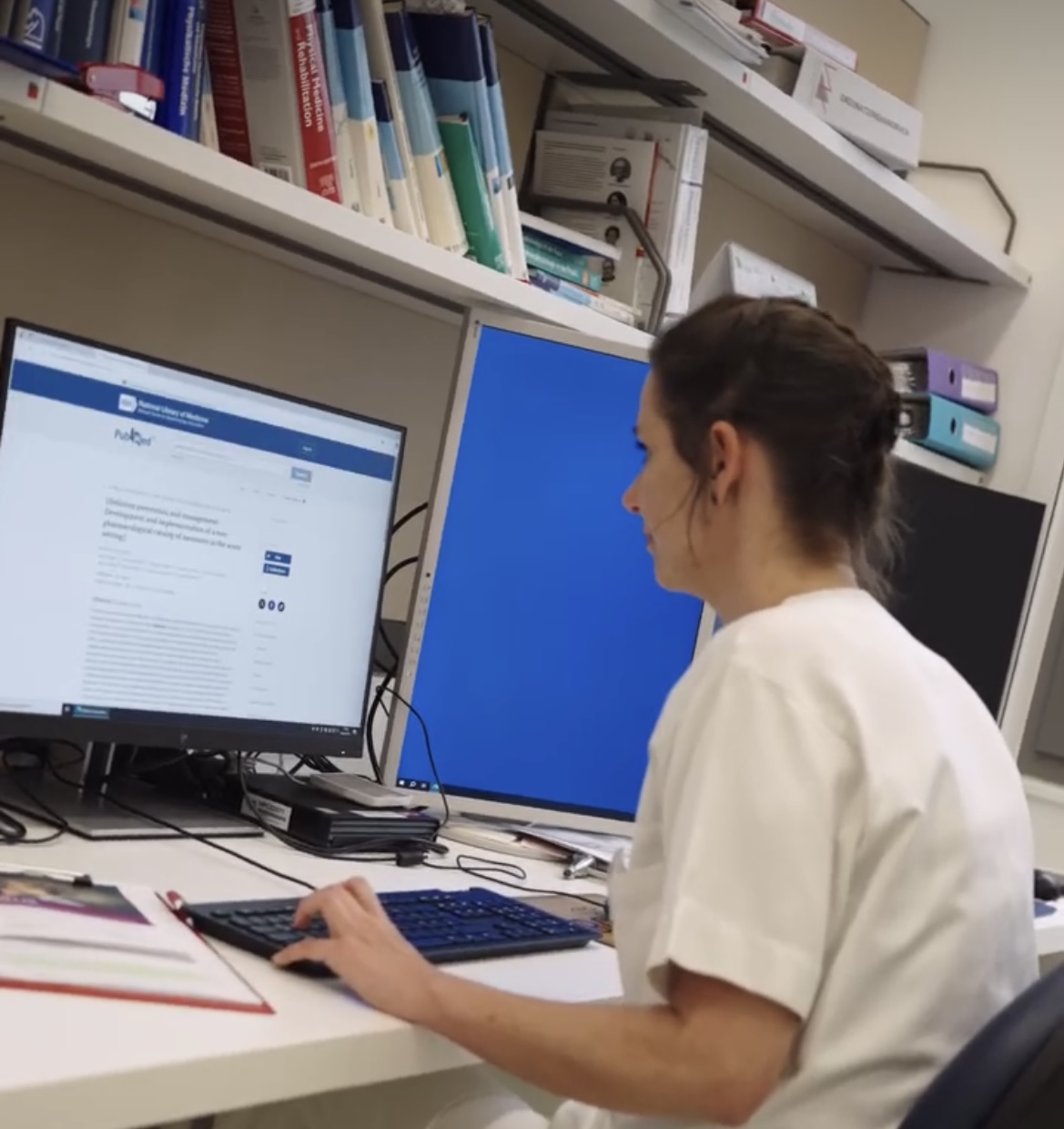

Delir kann Demenzrisiko erhöhen
Dennoch sind Delirs für Patient*innen, Angehörige und das Gesundheitssystem eine erhebliche Herausforderung. „Aktuelle Studien belegen, dass die Erkrankung nicht nur ein vorübergehender Verwirrtheitszustand ist, sondern oft mit einem längeren Krankenhausaufenthalt, schlechterem Behandlungsergebnis, verzögerter Rehabilitation, vorzeitiger Pflegebedürftigkeit oder erhöhter Mortalität verbunden ist“, erklärt Kelterer. Als Folge komme es oft zu Stürzen oder zusätzlichen Infektionen.
Etwa 25 Prozent der Betroffenen leiden dauerhaft unter kognitiven Funktionsstörungen. „Obwohl das Delir keine Demenzerkrankung ist, kann es das spätere Demenzrisiko erhöhen“, erläutert Kelterer. Gespräche mit betroffenen Patient*innen über das Erlebte sind für die Verarbeitung essenziell. „Schließlich geht ein Delir oft mit Alpträumen und akustischen oder olfaktorischen Halluzinationen einher, zum Beispiel einem Feuergeruch ohne Feuer. Das kann Patient*innen Angst machen.“ Auch wirtschaftliche Folgen sind messbar. Wie Studien belegen, können durch den längeren Krankenhausaufenthalt Mehrkosten bei der Behandlung von bis zu 52 Prozent entstehen.

Mit einem professionellen Delir-Management können wir bis zu 40 Prozent aller Fälle abfangen oder verhindern.
Mit einem professionellen Delir-Management können wir bis zu 40 Prozent aller Fälle abfangen oder verhindern.
Mag.a Cornelia Kelterer
Umso wichtiger ist es, ein Delir möglichst frühzeitig zu erkennen und Symptome rasch zu behandeln, um Folgeschäden zu minimieren. „Mit einem professionellen Delir-Management können wir bis zu 40 Prozent aller Fälle abfangen beziehungsweise verhindern.“ Ab Jänner 2026 implementiert das Herz-Jesu-Krankenhaus Wien eine KI (Künstliche-Intelligenz)-Assistenz zur Identifikation potenziell Betroffener. Das Programm schätzt mithilfe vorhandener Patient*innen-Daten das Risiko für die Entwicklung eines Delirs ein „Davon erhoffen wir uns eine weitere Verbesserung des Früh-Warnsystems und eine noch präzisere Behandlung.“
Schließlich ist die Reduktion der Häufigkeit und Schwere von postoperativen Delirs das oberste Ziel von Kelterer. So werden in standardisierten Screenings bereits vor einem Eingriff mögliche Risikofaktoren analysiert. Auch ein effektives Schmerzmanagement nach der Operation kann das Risiko senken. Ebenso ein Gehirntraining über kognitive Übungen, vor wie nach der OP.
Rasche Reorientierung
Wenn es trotz aller Präventionsmaßnahmen dennoch zu einem Delir kommt, ist neben der Behandlung des Auslösers die rasche Reorientierung Betroffener essenziell. Das gelingt über regelmäßige Mahlzeiten, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Beziehungsarbeit mit unterschiedlichen Gesundheitsberufen wie Angehörigen. „Sanfte Gespräche und vertraute Gegenstände wie Fotos können Ängste lindern und das Gehirn wieder ins Hier und Jetzt bringen“, spricht Kelterer aus Erfahrung. Manchen Patient*innen helfe der Geruch des vertrauten Duschgels, anderen die Lieblingsmusik, eine Uhr im Zimmer, die Brille zum Lesen oder das Hörgerät, idealerweise bereits im Aufwachraum. Da beim Delir der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört ist, muss auf einen geregelten Tagesablauf mit Aktiv- und Ruhezeiten geachtet werden. Eine frühe Normalisierung ist für den Behandlungserfolg essenziell. „Der Beruf ist ein spannendes Feld und gewinnt zunehmend an Bedeutung.“
Fotos: © Ralph Darabos; SCS Picture People; Vinzenz Magazin