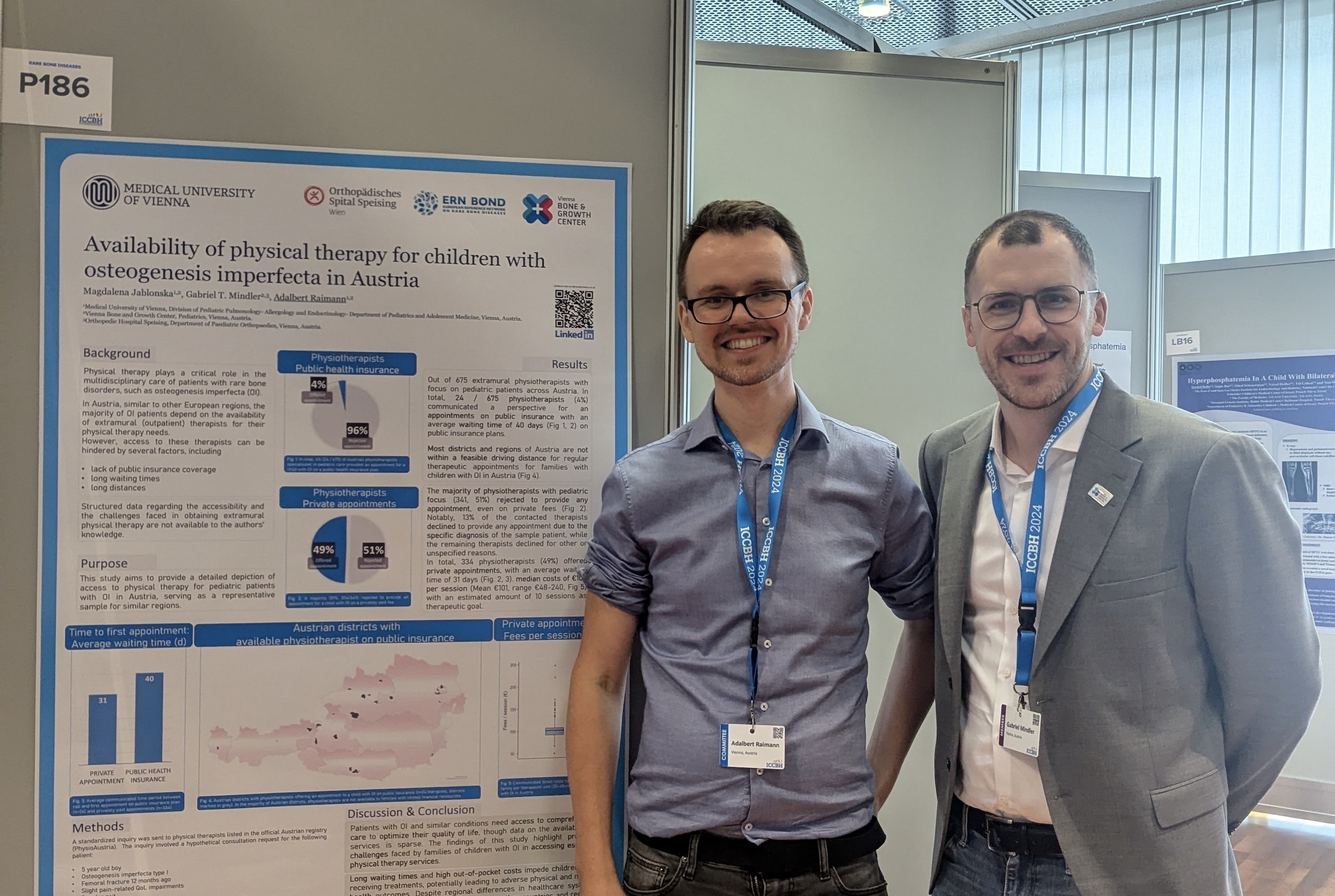
Gefährliche Lücke: Kindgerechte Laborwerte fehlen
Blutwerte entscheiden oft über Diagnose oder Entwarnung. Doch für Kinder fehlen in Österreich vielfach passende Referenzwerte. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, welche Folgen das für die Versorgung haben kann.
Text: Rosi Dorudi
Laborwerte sind ein zentrales Instrument der Medizin. Sie liefern Ärzt*innen entscheidende Hinweise für Diagnosen und Behandlungsentscheidungen. Doch Stoffwechsel und biologische Prozesse während des Wachstums und ihre Entwicklung unterscheiden sich deutlich von Erwachsenen. Damit weichen auch die Normbereiche vieler Laborparameter bei Kindern erheblich ab. „Genau hier liegt in Österreich ein gravierendes Problem: Kindgerechte Referenzwerte werden in vielen Laboren noch immer nicht ausreichend berücksichtigt“, erklären OA Dr. Gabriel Mindler, Kinderorthopäde am Orthopädischen Spital Speising, und Kinderendokrinologe Priv.-Doz. DDr. Adalbert Raimann von der MedUni Wien.
Welche Risiken daraus resultieren, haben die beiden Ärzte in einer vom Vienna Bone and Growth Center (VBGC) geleiteten Untersuchung deutlich gemacht: Die Forschenden verschickten eine standardisierte Testprobe als von einem vierjährigen Kind stammendes Material an 26 verschiedene österreichische Laborinstitute. Das Ergebnis war ernüchternd: Zwar wurden die Proben überall korrekt analysiert, doch der Großteil der Einrichtungen interpretierte die Werte als unauffällig – weil die Ergebnisse mit den Normbereichen für Erwachsene verglichen wurden.

Solange es keine verbindlichen Vorgaben gibt, wird einfach unterschätzt, wie wichtig altersgerechte Normwerte für Kinder sind.
Solange es keine verbindlichen Vorgaben gibt, wird einfach unterschätzt, wie wichtig altersgerechte Normwerte für Kinder sind.
Priv.-Doz. DDr. Adalbert Raimann
Gefährliche Fehldiagnosen
Für betroffene Kinder kann das schwerwiegende Folgen haben. „Wir erleben täglich das Problem, dass Kinder entweder unnötig auffallen, weil ein Sternchen beim Erwachsenenwert auftaucht, oder jahrelang keine Diagnose erhalten, weil der Wert nicht als pathologisch erkannt wird“, erklärt Raimann. Für die Studie der MedUni Wien untersuchten Raimann und sein Team exemplarisch zwei seltene genetische Knochenerkrankungen: die X-chromosomale Hypophosphatämie (XLH) und die Hypophosphatasie (HPP). „Beide Erkrankungen lassen sich anhand spezifischer Laborwerte leicht erkennen – bei XLH ist der Phosphatwert im Blut erniedrigt, bei HPP die Aktivität der alkalischen Phosphatase“, erläutert Mindler. „Diese beiden Erkrankungen sind sehr gute Beispiele, weil sie auf einen einzigen Laborwert heruntergebrochen werden können, der für die initiale Diagnose entscheidend ist.“ In der Studie zeigte sich, dass nur 18 Prozent der Labore für Phosphat und 41 Prozent für die alkalische Phosphatase altersgerechte Normbereiche verwendeten. „Dabei treten die klinischen Auffälligkeiten, die zu einer Labordiagnostik führen, meist im Vorschulalter auf: Beispielsweise, wenn Kinder von ihrer Wachstumsperzentile abfallen oder deutliche Achsabweichungen wie O-Beine oder X-Beine entwickeln“, so Mindler. „Wir wissen aber, dass nur ein Bruchteil der betroffenen Kinder rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Selbst wenn eine Ärztin oder ein Arzt die richtigen Tests anfordert, fehlt oft der Hinweis, dass der Wert auffällig ist.“
Das Problem liege dabei nicht in der Technik: Österreichische Labore lieferten sehr präzise Messwerte. Die Schwierigkeit bestehe vielmehr in der Interpretation. „Während in unserer Untersuchung einige wenige Labore die Referenzwerte korrekt umgesetzt haben, verglich der Großteil der Einrichtungen die Ergebnisse mit nicht passenden Normwerten", konstatiert Raimann und betont: „Solange es keine verbindlichen Vorgaben gibt, wird einfach unterschätzt, wie wichtig altersgerechte Normwerte für Kinder sind – es fehlt hier offensichtlich an Bewusstsein.“ Darauf möchte er mit der neuen Studie aufmerksam machen: „Kinder haben nur wenig Lobby. Deshalb ist es unsere Aufgabe als Mediziner*Innen, die politischen Entscheidungsträger auf diese Versorgungslücke hinzuweisen.“ Ein praktikabler Zwischenschritt wäre, dass Labore ohne eigene Kinderreferenzwerte dies offen vermerkten. „Somit wüssten die behandelnden Ärzt*innen sofort, dass sie die Blutprobe in ein spezialisiertes Labor schicken sollten. Damit wäre das Problem zumindest ein wenig entschärft“, schlägt er vor.

Selbst wenn eine Ärztin oder ein Arzt die richtigen Tests anfordert, fehlt oft der Hinweis, dass der Wert auffällig ist.
Selbst wenn eine Ärztin oder ein Arzt die richtigen Tests anfordert, fehlt oft der Hinweis, dass der Wert auffällig ist.
OA Dr. Gabriel Mindler
Internationale Perspektive
Dass es im Bereich der kindgerechten Laborreferenzwerte Nachholbedarf gibt, beschränkt sich nicht nur auf Österreich: „Auch international sehen wir, dass viele Labore bei Kindern weiterhin auf Erwachsenen-Normbereiche zurückgreifen“, berichtet der Kinderendokrinologe. „Auf europäischer Ebene gibt es jedoch Initiativen, um dies zu ändern. Die IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) und das Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) haben Leitlinien zur Bestimmung und Standardisierung alters- und geschlechtsspezifischer Referenzintervalle entwickelt.“ Auch Datenbanken wie das kanadische CALIPER-Projekt beweisen, dass umfassende, altersgerechte Referenzwerte technisch machbar sind und die Diagnostik erheblich verbessern. Raimann betont: „Solche Ressourcen zeigen, dass kindgerechte Werte durchaus möglich sind. Entscheidend ist, dass Labore diese Standards in der Praxis umsetzen.“ Die Ergebnisse der Studie machen deutlich: Nur mit verbindlichen Vorgaben, einem europaweiten Austausch bewährter Referenzwerte und größerer Sensibilisierung der Labore kann sichergestellt werden, dass Kinder korrekt therapiert werden und keine Erkrankung unentdeckt bleibt.
Die Studienautor*innen des Vienna Bone and Growth Center arbeiten nun zusammen mit den Fachgesellschaften daran, Lösungen und klare Strategien zu entwickeln, um Kindern und Jugendlichen in Österreich die gleiche hohe diagnostische Qualität und Sicherheit bei Laborbefunden zu gewährleisten, wie sie erwachsenen Patient*innen längst geboten wird.
Fotos: Titelbild © privat; Expertinnenbild Adalbert Raimann © privat; Expertinnenbild Gabriel Mindler © Anna Wandaller, OSS