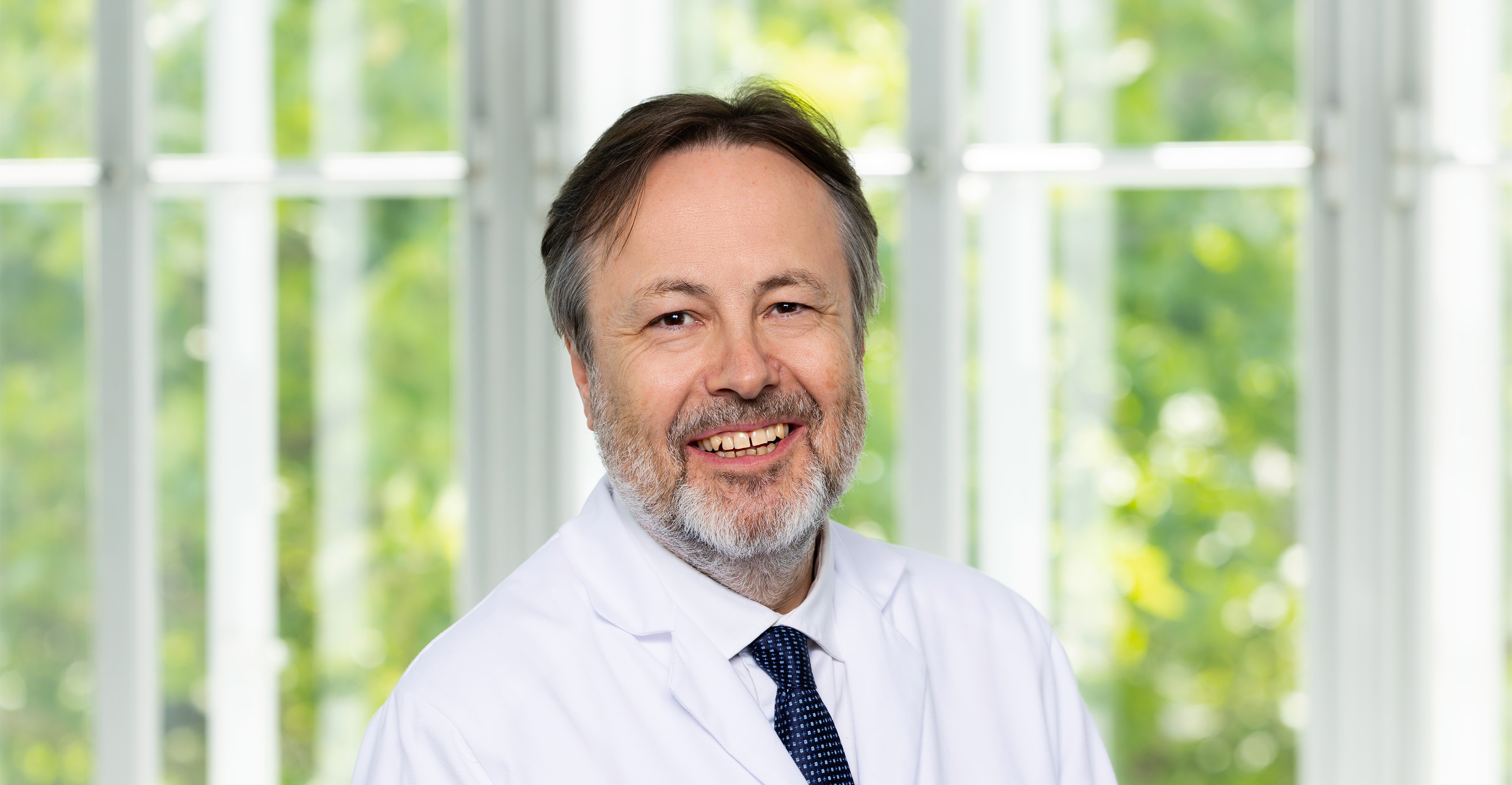
Mangel an Spenderorganen: neue medizinische Strategien
Derzeit können laut WHO nur zehn Prozent des weltweiten Transplantationsbedarfs gedeckt werden. Neue medizinische Strategien sollen dafür sorgen, dass Organe besser nutzbar werden.
Text: Birgit Weilguni
Nach den offiziellen Eurotransplant-Daten (Report 2024) liegt Österreich bei 18,1 Organspender*innen pro Million Einwohner*innen. In Deutschland – wo die Zustimmungslösung gilt – sind es 10,9, also nur knapp die Hälfte. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Transplantationen: Hierzulande werden 36,3 Nieren pro Million Einwohner*innen transplantiert, 25,5 in Deutschland. Bei Herztransplantationen liegt dieses Verhältnis bei 7,1 versus 4,0.
Die Widerspruchslösung sei mit Sicherheit ein wichtiger Vorteil für Österreich, bestätigt Univ.-Prof. Dr. Andreas Zuckermann, Herzchirurg an der Universitätsklinik für Herz- und Thorakale Aortenchirurgie der MedUni Wien, aber sie ist nicht der einzige Grund, warum bei uns mehr transplantiert wird als in vielen anderen Ländern. „Die gesetzliche Regelung macht einen spürbaren Unterschied und erleichtert die Organspende“, so Zuckermann. „Trotzdem ist die Realität komplexer. Entscheidend sind auch gut organisierte Intensivstationen, klare Abläufe in den Spitälern, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und Vertrauen in das System.“ Die Zahl der Transplantationen hänge immer auch davon ab, wie konsequent dieses Potenzial im Alltag genutzt wird.
Auf dem Gebiet von Spenderorganen gibt es eine sehr intensive internationale Zusammenarbeit. Österreich ist Mitglied von Eurotransplant, einer internationalen Organisation für Organaustausch und -allokation. In diesem Verbund werden rund 21 Prozent aller Spenderorgane grenzüberschreitend vergeben, in Einzelfällen auch außerhalb des Eurotransplant-Raums. Dieser internationale Austausch ist vor allem dann lebenswichtig, wenn es um hochdringliche Patient*innen mit hohem Sterberisiko auf der Warteliste geht, um Kinder oder um Betroffene mit seltenen Blutgruppen, speziellen Gewebemerkmalen oder hoher immunologischer ‚Schwierigkeit‘. Für diese Menschen ist die Chance auf ein passendes Organ oft nur durch eine internationale Vernetzung realistisch.
Medizinische Grenzen der Transplantierbarkeit
Nicht nur die eingeschränkte Zahl an Spenden, sondern auch die Tauglichkeit der entnommenen Organe wird häufig zum Problem. Von eingeschränkter Transplantationstauglichkeit ist die Rede, wenn Organe an medizinische Grenzen stoßen – und das passiert heute öfter als früher. Der wichtigste Grund: Organspender*innen in Europa sind in den vergangenen 20 Jahren deutlich älter geworden. Die Haupttodesursache ist längst nicht mehr der Verkehrsunfall mit Schädel-Hirn-Trauma, sondern neurologische Notfälle wie Hirnblutungen und schwere Schlaganfälle, erklärt der Experte. Dadurch ist das mittlere Spenderalter von etwa 35 auf rund 50 Jahre gestiegen. Mit diesem höheren Alter nehmen typische Begleiterkrankungen zu – Bluthochdruck, Diabetes, Gefäßverkalkung, Fettleber, vorgeschädigte Herzen oder Nieren.
„Viele dieser Patient*innen haben zudem einen langen und komplizierten Intensivverlauf hinter sich, mit Kreislaufproblemen, Infektionen und hohem Medikamentenbedarf. All das hinterlässt Spuren an den Organen“, ergänzt Zuckermann. „In der Praxis bedeutet das: Ein Teil der angebotenen Organe muss aus Verantwortung gegenüber den Wartelisten-Patient*innen abgelehnt werden, weil das Risiko eines schlechten Ergebnisses zu hoch wäre. Gleichzeitig haben wir gelernt, mit dieser veränderten Spendersituation umzugehen: durch bessere Diagnostik, strengere Auswahl, optimierte Operationstechniken und verbesserte Nachbetreuung. Entscheidend ist: Trotz älterer und vorbelasteter Spender*innen sind die Transplantationsergebnisse heute nicht schlechter geworden – im Gegenteil, sie sind in vielen Bereichen stabil gut.“
Perfusion und andere Lösungen
„Gegen altersbedingte Langzeitschäden in den Organen können wir heute (noch) kaum aktiv etwas tun – hier wird weltweit intensiv experimentell geforscht, etwa an Regeneration, Zelltherapien oder gezielten Medikamenten direkt am Organ“, sagt Zuckermann. „Was wir aber bereits sehr gut können: viel genauer hinschauen, bevor ein Organ transplantiert wird. Mit moderner Bildgebung, Laborparametern und funktionellen Tests lässt sich heute wesentlich besser als früher abschätzen, ob ein Organ für eine Transplantation wirklich geeignet ist oder ob das Risiko zu hoch wäre.“
Den größten praktischen Fortschritt der letzten Jahre bringt die Maschinenperfusion. Dabei werden Organe nach der Entnahme weiter mit einer Nährlösung – teils sogar mit sauerstoffreichem Blut – durchströmt. So können sie deutlich länger außerhalb des Körpers erhalten, in manchen Fällen sogar funktionell „auftrainiert“ oder stabilisiert werden. Gleichzeitig lassen sich die Transportwege verlängern, weil das Organ nicht mehr in wenigen Stunden transplantiert werden muss. „Gerade beim Herzen ist das entscheidend, da die klassische Ischämiezeit – also die Phase ohne Blut- und Sauerstoffversorgung – normalerweise nicht länger als vier bis fünf Stunden dauern sollte. Mit moderner Perfusionstechnik konnten bereits Herzen aus der Karibik nach Paris geflogen und dort erfolgreich transplantiert werden. Kurz gesagt: Wir können die Ursachen der Organschäden noch nicht beheben, aber wir werden immer besser darin, das Beste aus jedem einzelnen Spenderorgan herauszuholen“, gibt der Herzchirurg Hoffnung.
Als weitere Zukunftshoffnung gilt die Xenotransplantation – also die Transplantation tierischer Organe auf den Menschen, meist genetisch veränderte Schweineorgane. „Sie befindet sich derzeit in einer Art Nachdenk- und Lernphase. Die ersten Eingriffe der letzten Jahre haben gezeigt: Prinzipiell funktioniert es. Diese Organe können im Menschen eingesetzt werden und sind kurzfristig auch in der Lage, ausreichend Leistung zu erbringen. Gleichzeitig hat sich aber gezeigt, dass die immunologischen Probleme noch nicht zufriedenstellend kontrolliert werden können“, so Zuckermann. Aktuell arbeiten Forschungsteams weltweit intensiv daran, diese Abwehrmechanismen besser zu verstehen, um zukünftige Eingriffe gezielter und sicherer planen zu können. „Realistisch ist: Es wird noch einige Jahre dauern, bis Xenotransplantationen über experimentelle Einzelfälle hinausgehen und als breiter einsetzbare Option in der Transplantationsmedizin infrage kommen“, so Zuckermann.

Wir können die Ursachen der Organschäden noch nicht beheben, aber wir werden immer besser darin, das Beste aus jedem einzelnen Spenderorgan herauszuholen.
Wir können die Ursachen der Organschäden noch nicht beheben, aber wir werden immer besser darin, das Beste aus jedem einzelnen Spenderorgan herauszuholen.
Univ.-Prof. Dr. Andreas Zuckermann
Vielfältige Hindernisse
Ethische Rahmenbedingungen bremsen Forschende dabei jedoch nicht, sondern zwingen dazu, jede Entscheidung bewusst, transparent und verantwortungsvoll zu treffen, versichert der Herzspezialist. Tatsächliche Hindernisse haben viel mehr mit den Spenderzahlen zu tun als gesetzlichen Fragen. „Ein wichtiger Punkt ist die Struktur im Klinikalltag: Organspende braucht intensivmedizinische Kapazitäten, erfahrenes Personal, freie OP-Säle und Teams, die rund um die Uhr verfügbar sind. Wenn Intensivstationen überlastet sind oder Personal fehlt, gehen potenzielle Spender*innen manchmal buchstäblich ‚verloren‘, weil Prozesse nicht rechtzeitig angestoßen werden können“, so der Herzspezialist.
Dazu kämen logistische und organisatorische Hürden: Nicht jedes Spital meldet sofort konsequent mögliche Spenderfälle, Abläufe sind unterschiedlich eingespielt, und zwischen Diagnose des Hirntods, Gesprächen mit Angehörigen, Organisation der Entnahme und Transport des Organs muss vieles nahtlos funktionieren. „Auch wenn wir in Österreich eine Widerspruchslösung haben, spielen Haltung und Verunsicherung von Angehörigen eine Rolle – in emotionalen Ausnahmesituationen werden auch hier Organspenden abgelehnt“, bedauert Zuckermann.
Auf der Empfängerseite erschweren medizinische Faktoren die Situation: eine starke Sensibilisierung des Immunsystems, bestimmte Körpergrößenverhältnisse oder die häufige Blutgruppe 0, die nur von Spendenden derselben Gruppe Organe erhalten kann. All das kann die Wartezeit deutlich verlängern. „Man kann also sagen: Es ist nie nur der Mangel an Spenderorganen – es ist immer ein Zusammenspiel aus medizinischen, organisatorischen, personellen und gesellschaftlichen Faktoren, das am Ende darüber entscheidet, wie viele Organe tatsächlich transplantiert werden können“, fasst der Experte zusammen.
Zukunftsvisionen
Dass es in absehbarer Zeit eine Entspannung der Lage mit mehr Spenderorganen geben könnte, glaubt Zuckermann eher nicht: „Auf der Empfängerseite kommen sogar zusätzliche Indikationen dazu: Erwachsene mit komplexen angeborenen Herzfehlern, die schon mehrfach operiert wurden, oder Erkrankungen wie die Leichtketten-Amyloidose, die früher als Kontraindikation für eine Herztransplantation galten, können heute dank besserer Medizin überhaupt erst als Kandidat*innen für eine Transplantation infrage kommen.“
Auf der anderen Seite gebe es Entwicklungen, die den Bedarf eher abmildern: Manche Erkrankungen, die früher fast zwangsläufig in eine Transplantation führten, sind heute besser kontrollierbar – Hepatitis C ist inzwischen in vielen Fällen heilbar. Auch bei der schweren Herzinsuffizienz sind die Therapien deutlich besser geworden. „Dazu kommt die Kunstherztherapie (VADs), die immer häufiger eingesetzt wird: Menschen können heute bis zu zehn Jahre mit einem solchen System zu Hause leben. Das ist nicht mehr nur eine Überbrückung bis zur Transplantation, sondern für viele eine echte Alternative“, ergänzt Zuckermann und fasst abschließend zusammen: „Kurz gesagt: Der Engpass an Spenderorganen wird uns noch lange begleiten. Ich erwarte keine Wunder, aber ich erwarte, dass wir klüger, gezielter und vielfältiger behandeln – mit Transplantation als eine Option unter mehreren, nicht als einzigem Rettungsanker.“
Fotos: © MedUni Wien&Feelimage